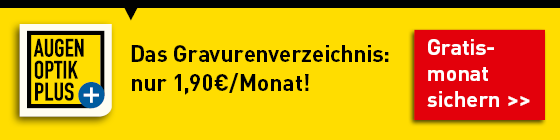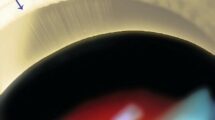Mit kaum einer anderen Eigenschaft hat die Evolution derart experimentiert wie mit dem Sehsinn. An ihm lassen sich deshalb alle Aspekte der Evolution besonders gut untersuchen. Text: Peter Laufmann
Der kleine Fisch Astyanax mexicanus aus der Familie der Echten Salmler hat ein ruhiges Leben. Gemütlich schwimmt er seine Runden in den Tümpeln, Seen und Bächlein Mexikos. Aufmerksam schaut er nach Tieren, die er fressen kann – und nach solchen, die ihn selbst fressen wollen. Seine Augen sind nicht besser oder schlechter als die anderer Fische. Standardware sozusagen. Dennoch ist er für Forscher ein Paradebeispiel dafür, wie die Evolution arbeitet. Von Zeit zu Zeit nämlich werden einige seiner Artgenossen aus ihrem Alltag gerissen, in eine der zahllosen Höhlen im durchlöcherten Untergrund Mexikos geschwemmt – und verlieren anschließend ihr Augenlicht. Weil sie nicht mehr zu sehen brauchen, bildet sich ihre Linse zurück. Aus den dunkelsilbrigen Fischlein des Sonnenscheins wer-
den augenlose, bleiche Geschöpfe der Dunkelheit. „Bei diesem Fisch kann man der Evolution bei der Arbeit zuschauen“, sagt Erhard Christian, Höhlenfaunist an der Universität für Bodenkultur in Wien. „Sehen und Nicht-mehr-Sehen sind nur einen Schritt voneinander entfernt.“
Noch sind die sehenden und die blinden Fische Varianten ein und derselben Art. „Sie lassen sich mühelos kreuzen“, sagt Christian; „und wenn man Linsen aus Embryos sehender Fische in Embryos blinder Fische einsetzt, bilden diese wieder ganz normale Augen aus.“ Doch dieses Auge auf Abruf wird es wohl nicht ewig geben. In einigen tausend Jahren könnte die Blindheit so fest im Erbgut der Fische verankert sein, dass aus dem gemeinsamen Urahn zwei verschiedene Arten geworden sind. Dabei muss es dem augenlosen Fisch keineswegs schlechter gehen. Er könnte seine Energie statt ins Sehen in andere Sinnesorgane wie sein Seitenlinienorgan stecken. Höhlenfische wie Astyanax zeigen, dass die Sehfähigkeit relativ leicht wieder verschwinden kann.
Die Option, zu sehen und gesehen zu werden, ist offenbar seit jeher ein starker Motor des Fortschritts. So hat die Evolution die vielfältigsten Lösungen gefunden, simple Rezepte ebenso wie raffinierte Spezialanpassungen, die auf die Lebensbedingungen der einzelnen Arten abgestimmt sind. Der Affe zum Beispiel sieht im grünen Dickicht des Dschungels sofort die bunte reife Frucht, und der Falke entdeckt aus großer Höhe die winzige Maus. Manche Schlangen finden ihre Opfer vor allem anhand der Wärmestrahlung, während der Frosch rasche Bewegungen erkennt, aber eine langsam laufende Fliege nicht sieht. Ein Hase hat den weitgespannten Panoramablick, sieht aber dafür zweidimensional. Und der Mensch nimmt ein breites Spektrum des Lichts wahr, während für viele Insekten nur der UV-Anteil interessant ist.
Mit kaum einer anderen Fähigkeit hat die Evolution derart ausgiebig experimentiert wie mit dem Sehsinn. Wenn man die Entwicklung der Augen als lineare Geschichte erzählt (die sie in Wahrheit nicht ist), dann ergibt sich eine beeindruckende Erfolgsstory. Aber man lasse sich nicht täuschen: Die Vorstellung einer permanenten, quasi zwangsläufigen Höherentwicklung bis zum vielseitigen Menschenauge als der Krone der Sehschöpfung ist eine Illusion. Viele Lebewesen nutzen heute noch dasselbe Augenmodell, das bereits ihren Vorfahren ein Fenster zur Welt geöffnet hat: einfache, aber bewährte Sehhilfen. Gut genug.
Am Anfang stand die bloße Unterscheidung zwischen hell und dunkel. Das schaffen bereits Einzeller wie der Dinoflagellat Euglena, ein einfacher Organismus, der sich im Wasser herumtreibt. Euglena ist durchsichtig und hat eine Geißel, die ihm bei der Fortbewegung hilft. An der Basis dieser Geißel sitzt ein kleiner, lichtempfindlicher Rezeptor und direkt daneben eine lichtdichte Pigmentzelle. Die Kombination hilft ihm bei der Orientierung. Sobald ein Lichtstrahl auf den Photorezeptor fällt, feuert er einen Impuls ab, der Einzeller bestimmt so seinen Kurs – Richtung Sonnenschein. Diese Opsine genannten lichtempfindlichen Rezeptoren dienten wohl ursprünglich der Energiegewinnung. Heute finden sie sich überall dort, wo gesehen wird. Im Menschenauge wie in der Heuschrecke. Wissenschaftler gehen davon aus, dass lichtempfindliche Einzeller von blinden Vielzellern vereinnahmt wurden und die ungleichen Partner eine Symbiose eingegangen sind: Der eine lieferte den Schutz, der andere den Sehsinn. Wie die Geschichte wirklich ablief, bleibt aber Vermutung; gallertartige Geschöpfe hinterlassen keine versteinerten Relikte. Der Seestern ist schon eine Stufe weiter. Sein Körper ist mit lichtempfindlichen Zellen übersät, die ihm mitteilen, ob seine Umwelt dunkel oder hell ist. Mehr allerdings nicht. Regenwürmer nutzen die Lichtsinneszellen schon genauer; diese liegen gehäuft an einem Körperende, so dass der Wurm einschätzen kann, wo Licht und Schatten sind. Auch manche Quallen haben ihre Lichtsinneszellen in Gruppen konzentriert, meist an den Enden der Tentakel. Man nennt diese Sehflecken Flachaugen. Damit können sie – in Schwarz-Weiß – lediglich sehen, dass ihnen etwas die Sicht nimmt. Sie erkennen aber nicht, was es ist.
Der nächste Schritt: Das Flachauge bildet eine Vertiefung; man spricht vom Grubenauge. Der Vorteil liegt auf der Hand: Das Licht erreicht nicht mehr alle Sinneszellen gleichmäßig, so dass die Richtung, aus der etwa ein Feind naht, viel präziser bestimmt werden kann. Die Napfschnecke lebt seit Millionen von Jahren mit diesem Augentyp.
Wenn die Grube sich noch mehr eintieft und ihre Öffnung sich zu schließen beginnt, wird ein Lochauge daraus. Das folgt demselben Prinzip wie eine Lochkamera: Durch eine kleine Öffnung fällt Licht; das Bild wird umgedreht auf eine Art Fotoplatte projiziert. Das Bild ist zwar dunkel, aber relativ scharf. Zudem sind die empfindlichen Sinneszellen in dieser Höhle geschützt. Der Nautilus – ein Kopffüßer, der aussieht wie ein Tintenfisch, der ein Schneckenhaus geklaut hat – benutzt so ein Lochauge. Es reicht ihm wohl, denn seit einer halben Milliarde Jahren ist es nahezu unverändert.
Sein Verwandter, der Tintenfisch, gibt sich damit nicht zufrieden: Bei ihm hat sich ein Stück Haut über die Öffnung geschoben. Was ursprünglich dem Schutz diente, bekam eine zusätzliche Funktion, die sich als entscheidender Vorteil erwies: Das durchsichtige Hautfitzelchen wirkt als Linse, die Lichtstrahlen bündelt. Das Bild, das der Tintenfisch sieht, ist nicht nur schärfer, sondern auch heller als das des Nautilus. Er sieht eine bunte und detaillierte Welt.
Der Weg von der Lichtsinneszelle zum Linsenauge ist allerdings nicht die einzige Entwicklungslinie, die die Evolution bei der Augenkonstruktion eingeschlagen hat. Eine ganz eigene Richtung eingeschlagen hat die Evolution der Facettenaugen, wie man sie bei Insekten oder Krebsen findet. Ihre Augen sind aus vielen Einzelaugen zusammengesetzt und liefern ein gepixeltes Abbild der Wirklichkeit (siehe Kasten rechts). In jedem Fall führt von der einfachen Sinneszelle bis zum komplexen Auge ein schier unendlich weiter Weg. Oder nicht? Zugegeben: Es ist schwer nachzuvollziehen, wie aus den einfachsten Strukturen Linsenaugen wurden. Selbst Charles Darwin hatte seine Schwierigkeiten damit: „Die Annahme, dass das Auge mit allen seinen unnachahmlichen Einrichtungen durch die natürliche Zuchtwahl entstanden sei, erscheint, wie ich offen bekenne, im höchsten Grade als absurd“, schrieb er in der „Entstehung der Arten“. Seine Zweifel lassen sich mittlerweile zerstreuen. Heute noch existierende Arten liefern Hinweise, wie die Evolution zu den modernen Sehwerkzeugen gekommen ist. Nicht nur der Vergleich des Augenaufbaus hilft die verschiedenen Schritte zu klären. Molekularbiologen erzählen die Geschichte anhand von Hinweisen im Erbgut und der am Sehen beteiligten Moleküle nach, Statistiker rechnen die unterschiedlichsten Modelle durch. Langsam verstehen wir das Wunder des Sehens.
Da ist zunächst der Faktor Zeit. Der schwedische Zoologe Dan-Erik Nilsson von der Universität Lund hat ein mathematisches Modell des Auges entworfen, um die Wahrscheinlichkeit der Augenevolution zu berechnen. Wenn man die Evolution einfach mal machen lässt – wie lange wird es wohl dauern, fragte er, bis sich ein komplexes Auge entwickelt? Nilsson begann mit der Darstellung einer einfachen Gruppe von Lichtsinneszellen und ließ sie sich im Computer verändern. Die Vorgabe: Maximal ein Prozent der Gestalt durfte sich von Generation zu Generation wandeln. Das Ergebnis war überraschend: Wenn man jeder Generation ein gutes Jahr einräumte, brauchte es nur 2000 Entwicklungsschritte, das heißt 360 000 Generationen oder knapp 500 000 Jahre, um zu einem Linsenauge zu kommen. Ein Wimpernschlag in der Erdgeschichte.
Hinweise auf den evolutionären Ursprung des Auges lieferte hingegen der Borstenwurm Platynereis dumerilii. Er besitzt bereits die verschiedenen Arten von Lichtsinneszellen, die sich in der Reizverarbeitung unterscheiden und noch heute in Fischen, Insekten oder Säugetieren vorkommen. „Die verschiedenen Typen wurden nur zu unterschiedlichen Augen weiterentwickelt“, erklärt Detlev Arendt vom European Molecular Biology Laboratory in Heidelberg. Dabei bekamen die Insekten die so genannten rhabdomeren Lichtsinneszellen mit auf den Weg, die Wirbeltiere den ciliären Typus – während der jeweils andere Typ verschwindet. Das ist ein wichtiger Grund, warum sich ein Katzenauge von einem Libellenauge auf den ersten Blick unterscheidet. Der fingerlange Borstenwurm, der seit 600 Millionen Jahren nichts für sein (Aus-)Sehen getan hat, hat sie noch beide. Ein deutlicher Hinweis auf einen gemeinsamen Urvater, der allen Tieren ihre Augen mitgegeben hat.
Interessant ist auch, welche Funktionen die beiden Lichtsinneszellen im Wurm übernehmen. Während der Entwicklung zum erwachsenen Tier werden die rhabdomeren Lichtsinneszellen zu den Augen, während die ciliären Zellen im Gehirn bleiben. Der Clou ist, dass eben diese ciliären Lichtsinneszellen unseren Zapfen und Stäbchen ähneln. „Im menschlichen Auge befindet sich die gleiche Art von lichtempfindlichen Zellen“, bestätigt Arendt. Den Beweis dafür lieferte der chemische Vergleich: Das lichtempfindliche Molekül Opsin des Wurmes entsprach dem Opsin des Menschen.
Doch seit den gemeinsamen Vorfahren hat sich eine Menge getan. Die Vielfalt, die dem Urahn folgte, ist atemberaubend. Jedes Auge, das in der Natur existiert, spiegelt die Umweltbedingungen und die Anforderung, denen sein Träger ausgesetzt ist – und vor allem die physikalischen Gegebenheiten. Goethe hat diesen Zusammenhang unnachahmlich knapp und poetisch zugleich ausgedrückt: „Wär’ nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnt’ es nie erblicken.“
So ist auch das Menschenauge, unsere Variante des Linsenauges, mit der ihm eigenen Kombination aus Stärken und Schwächen nur aus der Entwicklungsgeschichte des Menschen heraus zu verstehen. Unsere Augen sind, vereinfacht gesagt, deshalb so leistungsfähig und vielseitig, weil unsere Vorfahren klettern mussten und gerne reifes, bunt leuchtendes Obst aßen. Unsere Augen sind nach vorne gerichtet und erzeugen ein dreidimensionales Bild; allein so lassen sich Entfernungen präzise abschätzen. Dafür ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was wir sehen, überhaupt scharf. Aber auch so verschlingen unsere Augen große Mengen an Energie. Sie sind, bezogen auf die Größe, besser durchblutet und mit Sauerstoff versorgt als unser Herz.
Besonders wichtig für uns ist das Farben-Sehen. Wir sehen einen großen Teil des Spektrums und können viele, viele Farbnuancen unterscheiden. Unter den Säugetieren sind die Primaten die einzigen, die diese Fähigkeit in hohem Maß entwickelt haben. Für den Stier bleibt das rote Tuch des Torero farblos; auch das Reh juckt es herzlich wenig, ob der Jäger getarnt oder im quietschgelben Neonkostüm durch den Wald pirscht. Selbst Hunde oder Katzen sehen die Welt in schlichten Grün- und Rottönen. Doch für sie sind Farben kaum von Belang. Sie setzen auf die Fähigkeit, im Dunkeln sehen zu können. Dazu haben sie besonders viele Stäbchen, das heißt Sehzellen, die im Gegensatz zu den Zapfen nur für eine Wellenlänge empfindlich sind. Außerdem tragen sie hinter der Netzhaut eine reflektierende Schicht, das so genannte Tapetum lucidum. Diese Schicht reflektiert die einfallenden Lichtstrahlen und verstärkt sie so.
Das Sehen ist eines der großen Themen der Evolution. Und wie das Thema einer Sinfonie wird es von der Evolution immer wieder neu angespielt und variiert – oder schwingt unhörbar im Hintergrund mit. Selbst der blinde Grottenolm Proteus anguinus hält sich die Option offen, seinen Sehsinn bei Bedarf wieder zu aktivieren. Setzt man Grottenolme lange genug dem Licht aus, wird verstärkt Pigment produziert; das dünne Häutchen, das im Höhlenleben die Augen bedeckt, bildet sich zurück, und die Augen werden wieder funktionsfähig.
Die Evolution mag langsam voranschreiten, sich manchmal vorwärts, manchmal rückwärts entwickeln. Aber eine Pause macht sie nie.
(Erstveröffentlichung in der Zeitschrift „natur + kosmos“, April 2007, www.natur.de)
Mehr zum Thema
Internet:
Evolutionsmodell: www.biol.lu.se/funkmorf/vision/dan/Dan.html
Insektenauge: www.egbeck.de/skripten/12/bs12–45.htm
Katzenauge: www.wissenschaft-online.de/artikel/790821
Photorezeptoren: www.sinnesphysiologie.de/photor/
Teilen: